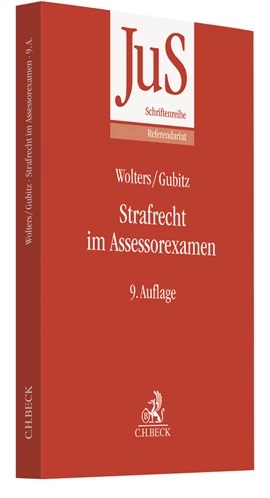Drei sogenannte EncroChat-Verfahren (mindestens) haben das Stadium der Hauptverhandlung am Landgericht Kiel erreicht (eine Einführung in das Thema finden Sie hier). Drei verschiedene Kammern sind bzw. waren befasst. Ein Verfahren ist mit einer Absprache und mehrjährigen Freiheitsstrafe vor kurzem beendet worden. In den beiden weiteren verteidigen insgesamt vier Kollegen unserer Kanzlei, und es hat in […]
Im Itzehoer Stutthof-Prozess sind heute (19. Oktober 2021) die Anklageschrift sowie Kammerbeschlüsse verlesen worden. Danach hat die Verteidigung ihr Opening Statement abgegeben. Am nächsten Hauptverhandlungstermin (26. Oktober 2021) soll mit der Beweisaufnahme begonnen werden. Frühere Beiträge zu diesem Verfahren finden Sie hier und hier.
Hat die Verteidigung bei der Durchsicht von vorläufig sichergestellten Datenträgern nach § 110 Abs. 1 StPO ein Anwesenheitsrecht? Diese Frage wird besonders in vielen wirtschaftsstrafrechtlichen Verfahren immer wieder kontrovers diskutiert, da dort regelmäßig auch umfangreiche sensible Datenbestände von unbeteiligten Dritten betroffen sind. Außerdem drohen, wie stets, Zufallsfunde. Die Rechtsprechung zum Thema ist rar und uneindeutig. […]
Sie finden hier eine kurze Stellungnahme aus Sicht der Verteidigung zum Verfahren. Das Landgericht Itzehoe hat auf die Beschwerde der Verteidigung hin den am 30. September 2021 erlassenen Haftbefehl außer Vollzug gesetzt. Für den nächsten Hauptverhandlungstag am 19. Oktober 2021 ist nun die Verlesung der Anklage geplant. Unser Kollege Niklas Weber wurde zum zweiten Pflichtverteidiger […]
Unser Hamburger Standort wächst weiter: Zum 1. Oktober 2021 ist Frau Carolin Püschel, LL.B., in die Kanzlei eingetreten und wird dort künftig als Rechtsanwältin und Strafverteidigerin tätig sein. Bereits im Rahmen ihres Studiums an der Bucerius Law School in Hamburg und an der Santa Clara University in Kalifornien (USA) hat Frau Püschel den Schwerpunkt ihrer […]
Auch sie gehört zum Alltag polizeilicher Ermittlungsmethoden und anwaltlicher Beschwerden: Die Durchsuchung von Wohnungen aufgrund von Gefahr im Verzug. Eigentlich sind die Grundlagen auf allen Seiten bekannt. Ob diese im Einzelfall unbewusst in Stresssituationen oder doch aus anderen Gründen außer Acht gelassen werden, ist nicht immer auszumachen. In dem hier dargestellten Fall hatte das Landgericht Kiel wieder einmal die Rechtswidrigkeit einer Durchsuchung festzustellen.
Ein alltägliches Geschehen: Bei einer Polizeikontrolle auf einem Parkplatz stellen die Beamten bei einem Betroffenen Marihuana-Geruch fest und bitten darum, in seine Bauchtasche sehen zu dürfen. Dieser willigt nicht nur hierin ein, sondern – als die Beamten eine Ecstasy-Tablette und eine geringe Menge Marihuana finden – auch darin, den Kofferraum seines Mercedes‘ zu öffnen. Diese […]
Die Leiterin des Unabhängigen Landeszentrums für den Datenschutz in Schleswig-Holstein, Marit Hansen, wird in den nächsten Tagen eine zweite Schadensersatzklage wegen Rechtsverstößen der Staatsanwaltschaft Kiel beim zuständigen Gericht einreichen. Dies ist bereits Gegenstand der Berichterstattung der Kieler Nachrichten („Klage gegen Staatsanwaltschaft: So reagieren die Fraktionen im Landtag auf Marit Hansens Vorwürfe“ und „SPD stellt Justizminister […]
Hauptverhandlung im Stutthof-Prozess vor dem Landgericht Itzehoe beginntUnser Partner Dr. Molkentin verteidigt seit dem 30. September 2021 (mittlerweile gemeinsam mit dem Kollegen Niklas Weber) eine Schreibkraft aus dem Konzentrationslager Stutthof vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts Itzehoe . Dieses Mandat ragt heraus aus der sonstigen Tätigkeit. Es geht um furchtbare Mordtaten (mit Zyklon B, mittels lebensfeindlicher Bedingungen und auf sogenannten Todesmärschen), an denen […]
Die Rechtsanwälte der Kanzlei Gubitz und Partner streiten sich seit Jahren mit der Staatsanwaltschaft Kiel über die Gewährung von Akteneinsicht aus laufenden Strafverfahren an Dritte (z.B. Versicherungen, Aufsichtsbehörden oder Krankenkassen), siehe unsere früheren Blog-Beiträge hier und hier und auch zum von der Landesbeauftragten für Datenschutz, Marit Hansen, geführten Verfahren. Nun musste erneut das Gericht in […]
„Top im Wirtschaftsstrafrecht“: Die Auswahl des Magazins Focus beruht auf den Empfehlungen von Kolleg*innen aus Wirtschaftskanzleien und Rechtsabteilungen von Unternehmen. Insgesamt haben 2.700 Anwält*innen und Inhouse-Jurist*innen teilgenommen.
Wenn Strafverfolgungsbehörden einen Durchsuchungsbeschlusses von den Ermittlungsgerichten haben wollen, sind leider die Anforderungen nicht besonders hoch (vgl. den Blogeintrag unseres Kollegen RA Dr. Momme Buchholz vom 19. April 2021). Speziell im Betäubungsmittelstrafrecht verschlechtert sich die Lage der Verteidigung noch durch die Weite der Tatbestände (insbesondere eines unerlaubten Handeltreibens): Man kann sich strafbar machen, ohne selbst […]
Strafrecht im Assessorexamen, 9., vollständig überarbeitete Auflage, München 2021, gemeinsam mit Prof. Dr. Gereon Wolters, Ruhr-Universität Bochum.
-
Strafrecht im Assessorexamen
-
9., vollständig überarbeitete Auflage
-
Prof. Dr. Michael Gubitz, Gereon Wolters
-
Gebundene Ausgabe: 196 Seiten
-
ISBN: 978-3-406-76557-5
Das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht hat auf unseren Antrag hin festgestellt, dass die Waffenbehörde des Kreises im Rahmen ihrer Zuverlässigkeitsprüfung keinen Anspruch auf Akteneinsicht in die staatsanwaltschaftliche Ermittlungsakte hatte. Wieder einmal wurde vorschnell einem Dritten Akteneinsicht gewährt: Gegen unseren Mandanten, der seit Jahren Inhaber eines Waffenscheins ist, wird ein Verfahren wegen Vorwürfen von Straftaten nach dem Arzneimittelgesetz, […]
Bislang gab es zu dem extrem praxisrelevanten Problem eines Anwesenheitsrechts der Verteidigung im Rahmen von § 110 StPO, soweit ersichtlich, nur sehr wenige gerichtliche Entscheidungen. Dabei geht es um die Sicherstellung und Mitnahme teils erheblicher Papier- und/oder Datenmengen durch die Ermittler zur Klärung der Frage, ob diese überhaupt für das Verfahren erheblich (und vom Durchsuchungsbeschluss […]
Unser Partner Rechtsanwalt Dr. Ole-Steffen Lucke gehört nach dem jüngst im Handelsblatt veröffentlichtem Ranking (Ausgabe vom 25. Juni 2021) zum ausgewählten Kreis „Deutschlands Beste Anwälte“ im Bereich Steuerstrafrecht. Die Auszeichnung genießt besondere Wertschätzung, da sie auf dem Ergebnis eines umfangreichen Peer-to-Peer-Verfahrens durch den US-Verlag Best Lawyers basiert, einem der etabliertesten und renommiertesten Bewertungsinstitute auf Peer-Review-Basis […]
AG Kitzingen folgt Rechtsauffassung von RA Buchholz Machen sich kirchliche Entscheidungsträger strafbar, wenn sie Kirchenasyl gewähren? Im Verlauf der strafjuristischen Aufarbeitung der sogenannten Flüchtlingskrise 2015/2016 wird diese Frage immer noch intensiv diskutiert. Wiederholt wurden Mönche, Pastorinnen oder Gemeinderatsmitglieder in den vergangenen Jahren wegen Straftaten nach § 95 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG verurteilt oder sie […]
Regelmäßig begehren Behörden (bspw. wegen Fragen der Zuverlässigkeit hinsichtlich der Fahrerlaubnis oder eines Waffenscheins) Einsicht in die staatsanwaltlichen Ermittlungsakten, und dies häufig ohne ausreichende Begründung. Ebenso schlank geht dann die Entscheidung der Staatsanwaltschaft vonstatten, die Akteneinsicht zu gewähren. Dass dies den gesetzlichen Voraussetzungen, die die Persönlichkeitsrechte des Beschuldigten wahren sollen, nicht gerecht wird und daher […]
Das Strafverfahren ist vorüber, die Strafe gezahlt oder abgesessen, aber nicht selten besteht eine hohe Belastung weiter: die Verfahrenskosten. Sie erreichen in immer mehr Verfahren durch ausufernde Telefonüberwachung und damit verbundene Dolmetscherkosten, eine möglicherweise für eine ganze Reihe von Verhandlungstagen bestehende Pflichtverteidigung in Fällen notwendiger Verteidigung oder, gerade auch in Wirtschaftsstrafsachen, Beauftragung von Sachverständigen mit […]
Rechtsanwalt und Strafverteidiger Niklas Weber wird uns ab sofort im Kieler Büro unterstützen. Daneben wird er weiter als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von Prof. Dr. Heinrich der CAU Kiel tätig sein. Kollege Weber hat die Strafverteidigung als Referendar in seiner neunmonatigen Anwaltsstation bei uns in all ihren Facetten und Anforderungen kennengelernt und dabei vom ersten […]
BetäubungsmittelstrafrechtIm Alltag der Strafverteidigung spielt der Umgang mit Hausdurchsuchungen eine herausragende Rolle. Hier prallen schon in einem frühen Verfahrensstadium hochwertige Interessen aufeinander: effektive Strafverfolgung vs. Unverletzlichkeit der Wohnung. Auf Drängen der polizeilichen Ermittler und bei oft noch sehr unklarer Verdachtslage (ein dringender Tatverdacht ist gerade nicht notwendig) stellen Staatsanwaltschaften die Anträge, Wohnung, Kraftfahrzeug und im […]
Die Schleswig-Holsteinische Rechtsanwaltskammer hat unserem Kollegen Felix Schmidt die Berechtigung verliehen, den Titel „Fachanwalt für Strafrecht“ zu führen. Foto: pepelange.de
Für das aktuelle Heft der Neuen Zeitschrift für Strafrecht durfte unser Kollege Gubitz das Editorial verfassen. Es sollte darin ein kurzes Schlaglicht auf den gesetzgeberischen Aktionismus im Bereich Strafrecht und Strafverfahrensrecht geworfen werden: „Im späten Herbst der Legislaturperiode liegt nach einem Referentenentwurf aus dem BMJV nun auch der Regierungsentwurf für neue Straf(verfahrens)normen vor. Dieser soll […]
In einem vor der V. Großen Strafkammer des Landgerichts Flensburg geführten Umfangsverfahren gegen einen Arzt und einen Apotheker (wir hatten über ein erfolgreiches Ablehnungsgesuch bereits berichtet) wurden den Angeklagten Betäubungsmittelmissbrauch und Abrechnungsbetrug im Zusammenhang mit Substitutionsbehandlungen (u.a. mit Methadon) vorgeworfen. Die Vorwürfe bezogen sich auf Sachverhalte, die bereits zehn bis zwölf Jahre zurückliegen. Nun wurde […]
Gubitz und Partner wurde wie schon im Vorjahr in der aktuellen WirtschaftsWoche-Listung im Rechtsgebiet Wirtschaftsstrafrecht als „TOP Kanzlei 2021“ ausgezeichnet. Außerdem wurde unser Partner Ole Lucke ebenfalls erneut als „TOP Anwalt 2021“ empfohlen. Das Handelsblatt Research Institute (HRI) fragte im Auftrag der WirtschaftsWoche rund 1300 Juristen aus 182 Kanzleien nach ihren renommiertesten Kollegen für Wirtschaftsstrafrecht […]
Die Rechtslage schien eindeutig, trotzdem wurde ein Haftbefehl beantragt. Gegen unseren Mandanten (und andere) wird wegen des Verdachts auf bandenmäßigen Subventionsbetrug im Zusammenhang mit Corona-Soforthilfen ermittelt. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung war er nicht zuhause. Als die Strafverfolger ihn antrafen, hatte er kein Handy dabei. Gerade das Mobiltelefon war aber nun von hohem Interesse für […]
Nach der Entscheidung BGH NStZ 2020, S. 434 ff. zu einer Beschwerde gegen die Nicht-Entpflichtung des bestellten Verteidigers hat unser Kollege Gubitz auch den Beschluss des BGH zur Beschwerde gegen die Entpflichtung in einem Praxiskommentar für die NStZ (2021, S. 176 ff.) besprochen. Zugetragen hat sich das Ganze in dem Verfahren wegen des Mordes an […]
Zwei der Kernstücke des Regierungsentwurfs des Gesetzes zur Fortentwicklung der Strafprozessordnung und zur Änderung weiterer Vorschriften betreffen die Einziehung und Vorschriften zur Revision. Der Ausschuss Strafprozessrecht der Bundesrechtsanwaltskammer hat dazu eine Stellungnahme abgegeben. Berichterstatter war neben dem Kollegen Prof. Dr. Knauer aus München unser Kollege Prof. Dr. Gubitz. Die Kritik der Kollegen an der geplanten […]
Einziehung von Bargeld in Höhe von 10.000,- € abgelehnt: Gegen unseren Mandanten wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln geführt und nach geraumer Zeit nach § 170 Abs. 2 StPO, also mangels hinreichenden Tatverdachts, von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Im Zuge einer Hausdurchsuchung waren im Tresor des Mandanten 10.000,- € gefunden worden. […]
In der ersten Ausgabe 2021 des Juris PraxisReports Insolvenzrecht hat unser Kollege Rechtsanwalt Dr. Buchholz sich mit einer Entscheidung des Landgerichts Regensburg (die Entscheidung finden Sie hier) zu den Voraussetzungen der Bestellung zum Pflichtverteidiger in Insolvenzstrafsachen auseinandergesetzt. Das LG Regensburg hatte in einem Strafverfahren wegen des Vorwurfs zweier vorsätzlicher (GmbH-) Insolvenzverschleppungen zu entscheiden, ob die […]
In einem am Landgericht Flensburg geführten Umfangsverfahren wurden vergangene Woche beide Hauptschöffinnen wegen der Besorgnis der Befangenheit (siehe zur einschlägigen Norm hier) erfolgreich abgelehnt. Da das Gericht zu Beginn des Verfahrens im Sommer 2020 zwei Ergänzungsschöff*innen hinzugezogen hatte, platzte der Prozess nicht, die Ergänzungsschöff*innen rückten auf. Dem Vorgang lag zugrunde, dass die Hauptschöffinnen am letzten […]
Am 9. Januar wurde im NDR ein Bericht über die beschleunigten Verfahren am Amtsgericht Neumünster ausgestrahlt, in dem unser Partner Strafverteidiger Gubitz zu Wort kam. Leider waren einige der Argumente, die gegen den „kurzen Prozess“ sprechen, zwar aufgenommen, aber nicht ausgestrahlt worden, so dass wir nun doch noch dieses Forum nutzen wollen, um das Wesentliche […]
Anklage wegen gewerbsmäßigen Diebstahls in 14 FällenAm Amtsgericht Kiel ist diese Woche ein gegen einen Paketzusteller geführtes Strafverfahren wegen angeblichen gewerbsmäßigen Diebstahls nach drei langen Hauptverhandlungstagen zu Ende gegangen. Aus dem Strafverteidiger-Alltag hatte sich dieses Verfahren wegen der notwendigen Hinzuziehung einer Sachverständigen für ein anthropologisches Identitätsgutachten abgehoben. Es gab nämlich Probleme bei der Bewertung von Foto-Aufnahmen aus einer Videoaufzeichnung des Paketsortierzentrums. […]
Polnisch-Deutsche RechtsgesprächeUnsere Kieler Kollegen Rechtsanwalt Dr. Buchholz und Rechtsanwalt Schmidt haben in dem jüngst herausgegebenen Sammelband „Polnisch-Deutsche Rechtsgespräche“ zwei Beiträge zur Auswahl von Sanktionen und Strafzumessung veröffentlicht. Dieser Sammelband dokumentiert einen Teil der Diskussions- und Vortragsveranstaltungen der Kieler Christian-Albrechts-Universität und der Adam-Mickiewicz-Universität in Posen (Polen), die alle zwei Jahre stattfinden, um deutschen und polnischen Rechtswissenschaftler/innen und Praktiker/innen […]
Die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Kiel ist heute mit einer Medien-Information zu einer weiteren von ihr erhobenen Anklage gegen Herrn Nommensen an die Öffentlichkeit getreten. Auch diese ist außergewöhnlich detailreich und (ab-)wertend. Eine solch aggressive Pressearbeit der Staatsanwaltschaft entspricht nicht der jahrelangen Übung und zeigt, mit welchen besonderen Energie die Verfolgung des Herrn Nommensen betrieben […]
Corona-Betrug – jetzt kommen sie also – die ersten Strafverfahren wegen angeblichen Subventionsbetruges im Rahmen der Corona-Soforthilfen. Sehr interessant ist natürlich, auf welchen Anfangsverdacht die Ermittlungen gestützt werden. Deswegen haben unsere Kollegen, die in aktuell in diesen Verfahren verteidigen, dem Eingang der ersten Akten mit Spannung entgegen gesehen, und, siehe da, die Geldwäschenormen sollen es […]
Vergangene Woche endete ein rechtlich spannendes Strafverfahren aus dem Bereich des Drogenstrafrechts am Amtsgericht Kiel, das unser Partner Dr. Martin Schaar als Strafverteidiger begleitete. Ein junger Mann war angeklagt, als Gehilfe mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Handel getrieben zu haben (1.000 Ecstasy-Tabletten). Das Gesetz sieht für dieses Delikt bei täterschaftlicher Begehungsweise eine Freiheitsstrafe von […]
Unser Kollege Gubitz war Berichterstatter für eine Stellungnahme des Ausschusses Strafprozessrecht der Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) zum „Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung der Strafprozessordnung und zur Änderung weiterer Vorschriften“. Die BRAK hat diese Stellungnahme übernommen und an einen bundesweiten Verteiler am Gesetzgebungsverfahren beteiligter öffentlicher Stellen sowie anwaltliche Berufsverbände, Fachverlage und überregionale Medien versandt. Mit dem Entwurf sollen […]
Unser Kollege Gubitz ist einer der Referenten beim Online-Forum Strafverteidigung, das vom 15. November bis zum 13. Dezember 2020 stattfindet. Dabei handelt es sich um ein digitales Forum für Rechtspolitik und Fortbildung. Es �finden insgesamt 18 verschiedene Module in unterschiedlichen Formaten statt, von Online-Vorträgen mit anschließender Diskussion, über Online-Diskussionen mit zugeschalteten Referent*innen bis zu live […]
Rezension zur Dissertation von Rechtsanwältin Dr. Gabriele StarkUnser auch im Steuerstrafrecht tätige Mitarbeiter RA Dr. Momme Buchholz hat in der aktuellen Ausgabe des Journals der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung 3/2020 (S. 195-197) die überaus interessante und gefällig geschriebene Dissertation der geschätzten Rechtsanwältin Dr. Gabriele Stark rezensiert. In der Arbeit geht es um die strafbefreiende Selbstanzeige gem. § 371 Abs. 1 AO im Rahmen von […]
Wann ist der Ladendiebstahl vollendet, wann nur versucht?Es gibt wohl kaum ein Amtsgericht in Deutschland, an dem nicht nahezu täglich ein Ladendiebstahl (strafbar nach § 242 StGB) verhandelt wird. In der Regel wird dem Beschuldigten vorgeworfen, einen Gegenstand in eine von ihm mitgeführte Hand-, Einkaufs-, Akten-, Jacken- oder ähnliche Tasche gesteckt zu haben (auch wenn er oder sie sich noch im Geschäft […]
Der Verteidigung liegen seit gestern die Anklage und die Medieninformation der Staatsanwaltschaft Kiel vor. Dazu soll heute nur das Folgende erklärt werden: Die Verteidigung nimmt die Anklageerhebung mit Unverständnis zur Kenntnis. Die Staatsanwaltschaft bleibt eine nachvollziehbare Erklärung dafür schuldig, warum sie Straftaten, die vom Strafmaß vergleichbar sind mit Sachbeschädigungen und einfachen Körperverletzungen, zum Landgericht anklagt. […]
Im Strafverfahren gegen den Polizeigewerkschafter Nommensen (wir haben darüber an dieser Stelle laufend berichtet, hier finden Sie unsere letzte Medieninformation) hatten die Ermittlungsbehörden auch sensible Datenbestände bei Dataport (dem Informations- und Kommunikations-Dienstleister der öffentlichen Verwaltung für die vier Bundesländer Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen und Sachsen-Anhalt) gesichert, ohne dass ein entsprechender Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluss vorlag. Das mit […]
Vermögensarrest: Zur analogen Anwendung des § 929 Abs. 2 ZPO im StrafprozessrechtIm Zivilrecht ist die Sache eindeutig: Nach § 929 Abs. 2 ZPO darf ein Vermögensarrest nach Ablauf eines Monats nicht mehr vollzogen werden. Unwiderleglich wird vermutet, dass der Gläubiger nach Ablauf dieser Frist über kein schutzwürdiges Sicherungsbedürfnis mehr verfügt. Im Gegensatz dazu sehen die das Vermögensarrestverfahren regelnden Normen des Strafprozessrechts (§§ 111e ff. StPO) keine […]
Das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht hat nunmehr mitgeteilt, dass das Land Schleswig-Holstein kein Rechtsmittel gegen das Urteil vom 26. Juni 2020 eingelegt hat. Damit hat die Klage der Schleswig-Holsteinischen Landesbeauftragten für Datenschutz Marit Hansen gegen die Staatsanwaltschaft Kiel Erfolg und es wird vom Gericht rechtskräftig eine unangemessen lange Verfahrensdauer bzw. eine rechtsstaatswidrige Verfahrensverzögerung festgestellt. Unsere Partner Dr. […]
Rechtsanwalt Dr. Buchholz hat im Juris-Praxisreport eine Entscheidung des AG Eilenburg zum Verkehrsordnungswidrigkeitenrecht (Beschl. v. 8.5.20 – 8 OWiG 147/20) kommentiert. Dieses hatte insbesondere zu entscheiden, ob der vom Betroffenen gegen das verhängte Bußgeld (in Höhe von 20,- EUR wegen eines Parkverstoßes) erhobene Einwand, Arbeitslosengeld II zu beziehen und daher zahlungsunfähig zu sein, durchgreift und […]
Der neue Praxiskommentar unseres Kollegen Gubitz in der NStZ befasst sich mit einem Thema, das bislang zu kurz kommt, uns schon länger unter den Nägeln brennt und, anders als die Leitsätze der besprochenen BGH-Entscheidung nahelegen, über die Pflichtverteidigung hinaus reicht. Es geht um das Mandatsverhältnis, Vertrauen und Verstöße gegen Mindeststandards der Verteidigung. Die kritische Reflexion […]
Im Jahr 2015 hatte die Staatsanwaltschaft Kiel gegen die Landesbeauftragte für Datenschutz Marit Hansen sowie einen Mitarbeiter des ULD ein auf haltlosen Vorwürfen eines gekündigten Mitarbeiters beruhendes Strafverfahren eingeleitet, das 2019 eingestellt wurde. Vorbereitet durch das Einlegen von insgesamt vier Verzögerungsrügen hatten unsere Partner Dr. Gubitz und Dr. Schaar Ende 2019 Entschädigungsklagen gegen das Land […]
Defizite in der Fehlerkultur,
schwere Versäumnisse gleich zu
Beginn des Verfahrens und Mängel in der
personellen Organisation der Staatsanwaltschaft.
Das Magazin Stern empfiehlt in seinem neuen Anwaltsranking die Kanzlei Gubitz und Partner für das Strafrecht. In der Print-Ausgabe 22/2020 und online hier nachzulesen. Für die Befragung wurden insgesamt 24.486 Anwältinnen und Anwälte zur Teilnahme eingeladen. Wir freuen uns über die Anerkennung:
Im Zuge der Blockadeauflösung auf dem Theodor-Heuss-Ring in Kiel im April 2019 wurden zahlreiche Bußgeldbescheide erlassen. Einen der Demonstranten hat Rechtsanwalt Dr. Buchholz nun erfolgreich vor dem Amtsgericht Kiel vertreten. Nachdem Amtsgericht und Staatsanwaltschaft sich bereits uneinig waren, konnte unser Mitarbeiter Dr. Buchholz für die Verteidigung auf die letztlich entscheidenden Gesichtspunkte hinweisen. Weder die ursprünglich […]
- anlässlich des Rücktritts von Innenminister GroteDer Rücktritt von Minister Grote steht im Zusammenhang mit den gegen Herrn Nommensen geführten Ermittlungen. Dass somit nun also ausgerechnet die beiden Amtsträger, die sich mit großer Energie der Aufklärung der Vorgänge in der Landespolizei gewidmet haben, durch die Ermittlungen eben dieser Landespolizei an den Pranger gestellt und auch persönlich demontiert werden, kann von Seiten […]
Haftbefehl vom Landgericht Lübeck aufgehoben Es funktioniert wie Paypal, ist aber bereits Jahrhunderte alt: Das muslimische Zahlungssystem Hawala-Banking. Hierunter versteht man die vertrauliche Erbringung von Finanzdienstleistungen außerhalb des regulierten und lizenzierten Marktes von Banken- und Finanztransferdienstleistern. Ursprünglich gedacht – und heute auch noch so genutzt – gewährleistet das Hawala-Banking unter Einschaltung von vertrauenswürdigen Mittelsmännern eine […]
Anerkennung für Dr. Ole-Steffen Lucke und die Kanzlei ingesamt:In der aktuellen WirtschaftsWoche-Listung im Rechtsgebiet „Wirtschaftsstrafrecht“ wurde Gubitz und Partner als „TOP Kanzlei 2020“ ausgezeichnet und unser Kollege Lucke als „TOP Anwalt 2020“ im Wirtschaftsstrafrecht empfohlen.Das Handelsblatt Research Institute befragte mehr als 1000 Juristen aus 150 Sozietäten. Die ausgewählten Anwälte wurden gebeten, die renommiertesten Kollegen zu […]
Unser Mandant war zunächst zu einer Gesamtfreiheitstrafe von 4 Jahren und 4 Monaten verurteilt worden. In einem späteren Verfahren erhielt er dann noch eine Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen, ohne dass mit der vorherigen Freiheitsstrafe eine sog. nachträgliche Gesamtstrafenbildung (§ 55 StGB) erfolgte. Die Staatsanwaltschaft hat die Bildung einer nachträglichen Gesamtstrafe (§ 460 StPO) […]
Normalerweise berichten wir hier von Fällen aus unserer Kanzlei. Allgemeine rechtliche Erörterungen halten wir für überflüssig, jede*r Interessierte*r kann mit ein paar Klicks im Internet genug juristisch Lesenswertes finden. Die Zeiten sind aber weit entfernt vom Normalen. Corona bestimmt unseren Alltag. Und das Virus hat auch das Strafrecht erfasst. Wir wollen Sie an unseren Diskussionen in der Kanzlei und auch unser Lektüre unbedingt empfehlenswerter anderweiter Veröffentlichungen teil haben lassen. Hier also ein paar Gedanken zu einigen sich aufdrängenden Rechtsfragen aus dem Bereich des Strafrechts:
Spätestens nach sechs Monaten verliert ein Vermögensarrest anordnender Beschluss seine rechtliche GeltungskraftDer Vermögensarrest ist für Beschuldigte eines Strafverfahrens ein nicht selten existenzbedrohendes Zwangsmittel. Seit der Reform des Einziehungsrechts im Jahr 2017 ist kaum ein Wirtschaftsstrafverfahren denkbar, in dem die Verteidigung gegen diese Maßnahme keine Rolle spielt. Nicht selten liegen zwischen der gerichtlichen Anordnung und der Vollziehung des Arrestes mehrere Wochen, manchmal sogar Monate. In letzteren Fällen […]
Wann ist die Beauftragung von Pflegekräften nach § 266a StGB strafbar? Die Frage nach der Scheinselbstständigkeit von Pflegekräften und die Folgen für das Arbeitsstrafrecht
Nicht zum ersten Mal konnte unser Partner Dr. Molkentin im Rahmen seiner Unternehmensverteidigung einen Erfolg gegenüber der Bundesnetzagentur erzielen. Diese drohte wiederholt die Verhängung von Bußgeldern wegen angeblich nicht genehmigter Nutzung von Funkfrequenzen an. Im aktuellen Fall hatte sich das Unternehmen bei der Agentur mehrfach um Klärung der rechtlichen Voraussetzungen des Funkbetriebs bemüht, ohne darauf […]
AG Kiel beschließt: Ermittlungsbehörden haben sechs Wochen Zeit zur Auswertung von SmartphoneNach Sicherstellung von Smartphone als Beweismittel: In einem Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln hat das Amtsgericht Kiel erfreulicherweise die vorläufige Sicherstellung auf sechs Wochen befristet. Rechtlicher Bezugspunkt der Entscheidung ist die Durchsicht eines Beweismittels nach § 110 StPO. Die Ermittlungsbehörden dürfen nach dieser Norm ein sichergestelltes Smartphone dahingehend durchsehen, ob sich Kommunikation, insbesondere Textnachrichten, […]
Dr. Buchholz veranstaltet gemeinsam mit Prof. Dr. Hoyer und dem Kollegen Dr. Elberling ein Seminar zu aktuellen Fragestellungen des Strafrechts an der Universität KielIm kommenden Sommersemester 2020 veranstaltet unser Kollege und Lehrbeauftragter der Universität Kiel Dr. Buchholz gemeinsam mit Prof. Dr. Hoyer und dem Kollegen Dr. Elberling ein Seminar zu aktuellen Fragestellungen des Strafrechts. Das Seminar richtet sich an Studierende des 6. Fachsemesters im Schwerpunkt Kriminalwissenschaften und dient der Vorbereitung auf das universitäre Staatsexamen. Thematisch geht es um […]
Sommersemester 2020 Das Seminar zum Strafprozessrecht von unserem Kollegen Prof. Dr. Gubitz wird als dreistündige Blockveranstaltung durchgeführt, Anmeldung und nähere Informationen laut Aushang.
Die Strafprozessordnung ist zum 13. Dezember 2019 – schon wieder – umfassend reformiert worden (BT-Drs. 19/14747). Ausweislich des Titels des Änderungsgesetzes soll die Reform der „Modernisierung des Strafverfahrens“ dienen. Darunter versteht der Gesetzgeber offenbar, wie bei nahezu jeder Neuerung der StPO der letzten 20 Jahre, vor allem eine tiefgreifende Beschränkung der Beschuldigtenrechte. Unser Mitarbeiter Rechtsanwalt […]
Das „neue“ (zu den ersten Entscheidungen nach der Gesetzesänderung siehe hier) Einziehungsrecht beschäftigt weiterhin Gerichte und auch die Anwälte unserer Kanzlei. Einen schönen Erfolg hat nun unser Kollege Schaar vor dem Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgericht errungen. Dieser weist über den entschiedenen Einzelfall hinaus; die Entscheidung befasst sich nämlich mit der sogenannten Entreicherung des von der Einziehung Betroffenen. […]
Der erste Untersuchungsausschuss der laufenden Legislaturperiode in Schleswig-Holstein versucht seit über einem Jahr, Vorgänge im Landeskriminalamt, die fast 10 Jahre zurück liegen, aufzuklären. Gegen hohe Polizeibeamte werden Vorwürfe erhoben, die von falschen Aktenvermerken und unterdrückten Beweisen bis zu Führungsversagen und Mobbing reichen (hierzu bspw. dieser KN-Artikel). Weil unser Kollege Gubitz als Beistand des wichtigen Zeugen […]
In der Dezemberausgabe der Neuen Zeitschrift für Wirtschafts-, Steuer- und Unternehmensstrafrecht (NZWiSt 12/2019) hat unser Partner Rechtsanwalt Dr. Ole-Steffen Lucke eine Anmerkung zu einer Entscheidung des Landgerichts Nürnberg-Fürth vom 21. Februar 2019 (18 Qs 30/173) veröffentlicht. Dr. Lucke setzt sich dabei mit der Frage auseinander, unter welchen Voraussetzungen sich ein Steuerberater bzw. sein Berufshelfer bei […]
Unser Partner Gubitz referiert auf der 14. Beck-Strafrechtstagung zum aktuellen Strafverfahrensrecht. Sein Thema wird § 265, die gerichtliche Hinweispflicht in der StPO, sein. Der Verlag bewirbt die Veranstaltung in München am 29. und 30. November folgendermaßen: „Auf der 14. Beck-Strafrechtstagung erwarten Sie hochspannende und topaktuelle Vorträge aus dem Strafverfahrensrecht. Erfahrene und erstklassige Praktiker aus BGH-Rechtsprechung und […]
Seit Juli 2017 erlebt die Einziehung eine Renaissance. Sehr häufig wird neben einer Verurteilung angeordnet, dass das durch eine Straftat Erlangte (bzw. ein entsprechender Wertersatz) eingezogen wird. So wird beispielsweise die Tatbeute eines Betruges oder eines Diebstahls dem Täter direkt vom Staat wieder genommen. Es müssen also nicht erst die Geschädigten zivilrechtlich in einem weiteren […]
Häufig sehen sich Beschuldigte beim Verdacht bestimmter Delikte, insbesondere bei Körperverletzungen, neben dem Strafverfahren auch noch einer Anordnung erkennungsdienstlicher Behandlungen nach § 81b Alt. 2 StPO ausgesetzt. Eine erkennungsdienstliche Behandlung nach dieser Vorschrift dient polizeilich-präventiven Zwecken, also der Gefahrenabwehr. Im Gesetz selbst werden keine besonderen Anforderungen an die Maßnahme formuliert, es reicht, dass diese „für […]
Unser Partner Dr. Molkentin hat in einem Verfahren vor dem Landgericht Kiel die Besetzung der Wirtschaftsstrafkammer mit nur zwei Berufsrichtern und zwei Schöffen gerügt. Zur Begründung hat er auf die in § 76 Abs. 3 GVG fixierte Regel verwiesen, nach welcher eine Zweier-Besetzung bei einer als Wirtschaftskammer zuständigen Strafkammer in der Regel nicht in Betracht […]
Am 29. und 30. Oktober 2019 hat in der Akademie Sankelmark die Tagung „Kindgerechte Justiz durch interdisziplinäre Zusammenarbeit“ stattgefunden. An der Veranstaltung nahm ein geladener Kreis von Staatsanwält_innen, Richter_innen, Polizeibeamt_innen, Ärzten, Psychologinnen, Rechtsmedizinerinnen, Vertreter_innen von Opferschutzorganisationen und Rechtsanwält_innen teil. Die Wertschätzung, die der Tagung in der schleswig-holsteinischen Justiz zuteil wird, kam durch die Anwesenheit der […]
Die 2. Öffentliche Stellungnahme im Verfahren gegen den stellvertretenden Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft DPolG – zu den Entscheidungen des Landgerichts – finden Sie hier.
In seinem Urteil vom 15.10.2019 (Az.: C‑128/18) hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) erstmals konkrete Kriterien für einzuhaltende Mindeststandards an Haftbedingungen aufgestellt, die im Rahmen einer Auslieferung aufgrund eines Europäischen Haftbefehls beachtet werden müssen. Dem lag eine von unserem Partner Rechtsanwalt Dr. Lucke gemeinsam mit dem Kollegen Rechtsanwalt Dr. Strate (Kanzlei Strate & Ventzke) eingelegte Verfassungsbeschwerde […]
Nachdem Herr Dr. Buchholz sich bereits im Dezember 2018 in einem ausführlichen Fachaufsatz der Straflosigkeit des Kirchenasyls gewidmet hat, veröffentlichte er nun in der Zeitschrift Strafverteidiger eine Anmerkung zum Urteil des Oberlandesgerichts München vom 3. Mai 2018 – 4 OLG 13 Ss 54/18 (StV 2019, S. 614 f.). Dr. Buchholz stimmt dem OLG München darin […]
Vor 10 Tagen haben im Rahmen eines Strafverfahrens gegen den stellvertretenden Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) Schleswig-Holstein Durchsuchungen statt gefunden. Hier die Berichterstattung des NDR. Herr Nommensen wird von unserem Kollegen Gubitz verteidigt. Dieser kritisiert die Einleitung des Strafverfahrens und den Erlass der Durchsuchungsbeschlüsse. Nachfolgend seine Stellungnahme (und eine Erklärung dazu, wieso die Verteidigung sich überhaupt gehalten […]
Die Berechnung der Höhe der Geldstrafe bei Beziehern von ALG I und II hat unser Mitarbeiter Dr. Buchholz im Juliheft der Zeitschrift Strafverteidiger (07/2019) in einem Fachaufsatz aufgearbeitet. Herr Dr. Buchholz vertritt in seinem Beitrag die Auffassung, dass aus dem Grundsatz der Strafgleichheit (Art. 3 Abs. 1 GG) und dem der Resozialisierung (Art. 20 Abs. […]
Vorbemerkung: Wir veröffentlichen den Ausgang bestimmter Strafverfahren, in denen Kollegen der Kanzlei als Verteidiger tätig waren, vor allem aus folgendem Grund: Es gibt zahlreiche Fälle, in denen über die Einleitung eines Verfahrens medial intensiv und mit der Ausbreitung aller zu diesem Zeitpunkt noch völlig unbewiesenen Details berichtet wird. Bestätigen sich die Vorwürfe nicht und enden die Ermittlungen mit Freispruch oder sogar […]
Weitergabe von Daten aus Strafverfahren an Arbeitgeber eines Beschuldigten unzulässigWelche Informationen aus laufenden Ermittlungsverfahren die Strafverfolgungsbehörden an Dritte weitergeben dürfen, ist u.a. in der „Anordnung über Mitteilungen in Strafsachen“ (MiStra) geregelt. Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass Polizeibeamte oder auch Staatsanwältinnen und Staatsanwälte rechtswidrig Informationen preisgeben. In dem Fall, in dem Kollege Gubitz verteidigte, war es ein Angestellter im Bereich der Heilberufe, den […]
Im Juniheft der Neuen Zeitschrift für Wirtschafts-, Steuer- und Unternehmensstrafrecht (NZWiSt 6/2019) hat unser Partner Rechtsanwalt Dr. Ole-Steffen Lucke eine Anmerkung zu einer Entscheidung des 3. Strafsenats des Bundesgerichtshofs vom 4. Oktober 2018 (3 StR 283/18) veröffentlicht. Aus der Vielzahl der diskussionswürdigen Aspekte dieses Beschlusses greift der Kollege Dr. Lucke zum einen die Frage der […]
Unser Partner Dr. Schaar war mit einem Antrag auf gerichtliche Entscheidung gemäß § 109 StVollzG erfolgreich. Mit diesem Rechtsmittel kann sich ein Strafgefangener gegen die Vollzugsplanfortschreibung wenden, insbesondere also gegen die Versagung von Lockerungen sowie die Verweigerung der Unterbringung im offenen Vollzug. Die Anstalt hatte nur Ausführungen zur Vorbereitung von Lockerungen gewährt. Zur Begründung führte […]
Für unsere Mandant:innen ist es nur selten erstrebenswert, wenn sich die öffentliche Aufmerksamkeit auf ihr Verfahren richtet. In der überwiegenden Anzahl unserer Fälle ist daher auch Diskretion oberstes Gebot. In Einzelfällen veröffentlichen wir aber Stellungnahmen zum Ausgang oder auch Zwischenstadien unserer Strafverfahren. Dies hat folgenden Grund: Es gibt Fälle, in denen über die Einleitung eines […]
In einer Anmerkung im JurisPraxisreport-Insolvenzrecht 06/2019 zu einem Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt (Oder) vom 26.11.2018 (412 Ds 237 Js 13913/17 [2/18], 412 Ds 2/18) setzt sich unser Mitarbeiter Dr. Buchholz kritisch mit der – überaus praxisrelevanten – Reichweite des Beweisverwendungsverbots nach § 97 Abs. 1 S. 1 und 3 InsO auseinander. Gegenstand des Strafverfahrens war […]
- ein UpdateUnser Partner Gubitz vertritt einen der beiden Polizeibeamten, die ab Montag, dem 28. Januar 2019, als erste Auskunftspersonen vom 1. Parlamentarischen Untersuchungsausschuss der laufenden Wahlperiode des Landes Schleswig-Holstein vernommen werden. Die zugrunde liegenden Vorgänge liegen viele Jahre zurück: Bereits im Mai 2011 hatte sich der Kollege Gubitz an das Innen- und das Justizministerium des Landes […]
Eine der durchaus raren beschuldigtenfreundlichen Änderungen der StPO durch das „Gesetz zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens“ (BGBl. I, 3202, 3210), in Kraft getreten am 24.8.2017, ist im neuen § 265 Abs. 2 StPO zu finden. Ein rechtlicher Hinweis ist nunmehr bereits dann zu erteilen, wenn 1. sich erst in der Verhandlung vom Strafgesetz besonders vorgesehene […]
Am 23.3.2017 hat der Deutsche Bundestag eine umfassende Neuregelung der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung beschlossen, am 1. Juli 2017 ist das neue „Einziehungsrecht“ in Kraft getreten. Verbrechen sollte sich noch nie lohnen, nach dieser Komplettrenovierung der entsprechenden Vorschriften des materiellen Rechts und der Strafprozessordnung aber nun erst recht nicht (mehr). Das neue Recht bringt (wenig) Licht und […]
Am 26. Februar 2019 hat vor dem Landgericht Kiel der Prozess gegen leitende Mitarbeiter der Firma Sig Sauer begonnen. Die Anklage wirft drei Personen vor, Pistolen ohne die erforderliche Genehmigung ausgeführt zu haben. Unsere Partner Prof. Dr. Gubitz und Dr. Lucke verteidigen einen der damaligen Geschäftsführer. Die Vorgänge liegen fast 10 Jahre zurück, und es […]
Unser Hamburger Partner, Rechtsanwalt Dr. Lucke, war einer der Referenten des „5. Internationalen Strafrechtstag“ am 5.4.2019 in München (veranstaltet durch den renommierten Deutschen Strafverteidiger e.V.). Dr. Lucke berichtete von der erfolgreichen Verfassungsbeschwerde gegen eine Auslieferung nach Rumänien aufgrund eines Europäischen Haftbefehls. Diese hatte er gemeinsam mit dem Kollegen Rechtsanwalt Dr. Strate erhoben (Az.: 2 BvR […]
Am 26. Februar 2019 hat vor dem Landgericht Kiel der Wirtschaftsstrafprozess gegen leitende Mitarbeiter der Firma Sig Sauer begonnen. Die Anklage wirft drei Personen vor, Pistolen ohne die erforderliche Genehmigung ausgeführt zu haben. Unsere Partner Prof. Dr. Gubitz und Dr. Lucke verteidigen Michael Lüke, einen der damaligen Geschäftsführer. Die Vorgänge liegen fast 10 Jahre zurück, […]
Im aktuellen Heft 14 der Neuen Juristischen Wochenschrift ist eine weitere Anmerkung unseres Partners Prof. Dr. Gubitz zu einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs zum noch neuen Einziehungsrecht erschienen (NJW 2019, 1008 ff.). Im Kern hatte der BGH hier entschieden, dass das Schlechterstellungsverbot auch für die Einziehung nach den §§ 73 ff. StGB (beispielsweise von Taterträgen) gilt. […]
In einem Revisionsverfahren vor dem Bundesgerichtshof (Az.: 5 StR 312/18) verteidigte unser Partner Rechtsanwalt Dr. Lucke einen Mandanten, der zuvor durch das Landgericht Hamburg wegen bandenmäßigen Betruges in vier Fällen sowie wegen Betruges in zwei Fällen zu einer Bewährungsstrafe von 2 Jahren verurteilt worden war. Zusätzlich hatte das Landgericht Hamburg die Einziehung des Wertersatzes in […]
In der sich schwerpunktmäßig dem Wirtschaftsstrafrecht widmenden Januarausgabe des Strafverteidigers (StV 2019, 36 ff.) hat unser Mitarbeiter Dr. Buchholz eine Entscheidung des BGH zur Untreuestrafbarkeit (BGH, Beschl. v. 20.6.2018 – 4 StR 561/17) kritisch analysiert. In dem zugrunde liegenden Strafverfahren war ein Geschäftsführer einer in eine GmbH teilprivatisierten städtischen Müllabfuhr wegen verschiedener Untreuevorwürfe angeklagt. Im […]
In einem in erster Linie an Rechtsreferendare gerichteten Beitrag setzt sich unser Mitarbeiter Dr. Buchholz gemeinsam mit Rechtsanwalt Kersig (Leinemann & Partner, Berlin) in der aktuellen Ausgabe der Juristischen Schulung (JuS 2019, S. 351 ff.) mit dem überaus praxisrelevanten Bereich der erkennungsdienstlichen Behandlungen nach § 81b Var. 2 StPO auseinander. Nach dieser Vorschrift dürfen, soweit es für die Zwecke […]
In Heft 1/2019 des C.H. Beck‘schen Newsdienst Compliance beschäftigt sich unser Partner Rechtsanwalt Dr. Lucke mit einer problembehafteten Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Köln (6 Sa 652/18), nach der dem Geschäftsherrn gegenüber einem bestochenen Angestellten ein zivilrechtlicher Auskunfts- und Rechenschaftsanspruch in Bezug auf das erhaltene Schmiergeld (dem Vorteil i.S. des § 299 StGB) zustehen soll. Dr. Lucke […]
Unser Mitarbeiter Dr. Momme Buchholz hat in der online frei verfügbaren und lesenswerten Kriminalpolitischen Zeitschrift die Dissertation von Danielle van Bergen zu § 201a StGB besprochen, ein PDF finden Sie hier: buchholz-danielle-van-bergen-abbildungsverbote-im-strafrecht § 201a lautet: Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 1. von einer […]
Im Deubner-Verlag ist nun in erster Auflage ein neu konzipiertes Hilfsmittel für die Verteidigung in der strafrechtlichen Hauptverhandlung erschienen. Unsere Partner Lucke und Molkentin sind mit Beiträgen zur Gerichtsbesetzung (Kapitel 2) und zum Urkundsbeweis (Kapitel 21) vertreten. Auf der Homepage des Verlages finden Sie nähere Informationen zu Inhalt und Konzeption des 1.400 Seiten starken Werkes, […]
Unser Partner Gubitz vertritt einen der beiden Polizeibeamten, die ab Montag, dem 28. Januar 2019, als erste Auskunftspersonen vom 1. Parlamentarischen Untersuchungsausschuss der laufenden Wahlperiode vernommen werden. Die zugrunde liegenden Vorgänge liegen viele Jahre zurück: Bereits im Mai 2011 hatte sich Herr Gubitz an das Innen- und das Justizministerium des Landes Schleswig-Holstein, die Behördenleitung der […]
In der Dezemberausgabe 2018 des Newsdienst Compliance wurde das Editorial durch den Leiter des Hamburger Standortes unserer Kanzlei, Rechtsanwalt Dr. Ole-Steffen Lucke, verfasst. Hierin bietet er einen kompakten Jahresrückblick über die Entwicklungen und Ereignisse im Bereich Compliance. Hervorzuheben sind nach seiner Ansicht insbesondere die Kontroverse über die Frage der zukünftigen Sanktionierung von Compliance-Verstößen im Unternehmen […]
Am 21.12. begann vor dem Landgericht Kiel ein Prozess wegen des Vorwurfs des gewerbs- und bandenmäßigen Betruges (sog. Polizistentrick). In dem Verfahren verteidigt unser Partner Rechtsanwalt Gubitz gemeinsam mit dem geschätzten Kollegen Dr. Jürgen Meyer aus Verden. Am ersten Hauptverhandlungstag sahen sich beide Verteidiger gehalten, dem Recht des Angeklagten auf den gesetzlichen Richter (Art. 101 […]
In einer Anmerkung im JurisPraxisreport-Insolvenzrecht 25/2018 zu einem Beschluss des Landgerichts Essen vom 16.7.2018 (32 KLs 3/17 BEW) setzt sich unser Mitarbeiter Dr. Buchholz kritisch mit der Anordnung einer Bewährungsauflage zur Schadenswiedergutmachung zugunsten der Insolvenzmasse auseinander. Das LG Essen hat in dem o. g. Beschluss angenommen, dass derartige Auflagen nicht nur bei Verurteilungen wegen eines […]